Entwicklung vom Ei zur Ameise (Imago)
Einleitung
Wie bei vielen anderen Insekten verläuft auch die Entwicklung der Ameisen von der Eiablage bis zur fertig entwickelten Ameise die sogenannten Imago in vier Schritten.
Im folgenden Abschnitt wird nur auf die Entwicklung der Arbeiterinnen eingegangen Die Bedingungen und Voraussetzungen, unter denen sich weibliche und männliche Geschlechtstiere entwickeln, werden in einem anderen Abschnitt behandelt.

Hügelbauende Waldameise beim Trasport einer Ameisenpuppe
Nach der Sonnenphase erfolgt die Ablage der so genannten Polplasaeier im oberen Teil des Nestes. Aus diesen Eiern entwickeln sich die geflügelten Königinnen und Drohnen. Danach zieht sich die Königin wieder in die tieferen Bereiche des Baus zurück. Hier, gut geschützt vor Gefahren, beginnt sie in ihrer Brutkammer mit der mehrmonatigen Eiablage zur "Arbeiterinnenproduktion".
Aus welchen Gründen auch immer wir Menschen Sperma in Samenbanken lagern bei den Ameisen kann man die Königin selbst als eine Art Samenbank betrachten.
In Anbetracht der Tatsache, dass männliche Drohnen nur wenige Tage bis Wochen leben, ist es umso erstaunlicher, dass sie auch nach 20 Jahren noch in der Lage sind, Vater zu werden!
Und so geht's: Bei der Begattung durch das männliche Geschlechtstier hat die Königin so viel Sperma erhalten das dieser für ein ganzes Königinnenleben ausreicht. In einem Speicherorgan, der so genannten "Spermathek", werden die Spermien bis zu ihrem Einsatz durch verschiedene Faktoren wie Nährstoffzufuhr, bestimmten Temperaturen in einer geschützten Umgebung am Leben erhalten.
Da sich Arbeiterinnen immer aus befruchteten Eiern entwickeln, wird das Ei auf dem Weg durch den Geschlechtstrakt an einem Muskel vorbeigeführt, der bei jedem Ei einige Samenfäden aus der Samenblase freigibt. Erst jetzt findet die eigentliche Befruchtung mit den aufbewahrten Samen statt.
In allen weiteren Entwicklungsphasen ist der Nachwuchs auf die ständige Hilfe und Unterstützung der Arbeiterinnen angewiesen. Auf sich allein gestellt hat der Nachwuchs keine Chance, sich zu Arbeiterinnen zu entwickeln.
Eiablage und Ameiseneier
Die Aufgabe der Ameisenkönigin ist es, den Fortbestand des Ameisennestes durch ununterbrochene Eiablage zu sichern. Schon bei der Eiablage müssen Arbeiterinnen zur Stelle sein, um die Eier abzunehmen und in handlichen Paketen in separate Brutkammern im unteren Teil des Nestes zu bringen.
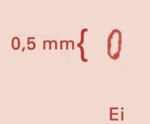
Die Größe der milchig-weißen Eier liegt zwischen 0,5 und 0,7 mm. Dies ist vergleichbar mit Salzkörnern in einem Salzstreuer.
Die zu kleinen Paketen zusammengeklebten Eier werden von den Arbeiterinnen ständig beleckt und umgelagert. Durch das Belecken wird die Brut sauber und feucht gehalten. Außerdem hat der Speichel eine desinfizierende Wirkung und durch die Eihülle hindurch werden Stoffe übertragen, die für die Entwicklung des Embryos wichtig sind.
Bei der Lagerung wird ständig auf eine optimale Temperatur (20 bis 25 Grad) und Luftfeuchtigkeit geachtet. Nach etwa 12 bis 14 Tagen schlüpfen die Larven aus ihren Eiern.
Interessant wäre natürlich die Frage. Wie viele Eier legen unsere Waldameisen eigentlich?
Hier muss unterschieden werden zwischen den meist monogyn lebenden Großen Roten Waldameisen (eine Königin) und den meist polygynen Nestern der Kleinen Roten Waldameise (viele Königinnen).
Die Kleine Rote Waldameise kommt mit etwa 10 Eiern pro Tag aus. Die Große bringt es auf etwa 300 Eier pro Tag. Und das 20 bis 25 Jahre lang.
Zum Vergleich: Eine Art der Treiberameisen schafft es auf 50 Millionen Eier pro Jahr.
Larve
Das folgende Larvenstadium wird in 8 bis 10 Tagen durchlaufen, wobei die Nesttemperatur eine wichtige Rolle spielt. Die Larven haben keine Beine, keine Mundwerkzeuge und keine Augen und sind daher völlig hilflos und auf die Hilfe der Arbeiterinnen angewiesen.

Larve der hügelbauenden Waldameisen
Neben dem Transport zu den optimalen Plätzen müssen die Arbeiterinnen nun auch für die Fütterung der Larven sorgen. Dazu wird in der Regel hochwertiger, eiweißreicher Kropfinhalt verwendet.
Dadurch wächst die Larvenhülle ständig und wird immer enger. Dieser Platzmangel wird durch mehrere Häutungen ausgeglichen. Nach der vierten Häutung beginnt das nächste Entwicklungsstadium.
Diese wird eingeleitet mit dem Einspinnen der Larve in einen Kokon. Dabei wird sie von den Arbeiterinnen unterstützt. Der Spinnfaden wird von der Larve in einer speziellen Drüse produziert.
Puppe
In der Puppe findet die eigentliche Umwandlung statt, die Metamorphose von der Larve zum Insekt. Die Puppen sind zwischen 6 und 8 mm groß und werden oft fälschlicherweise als Ameiseneier bezeichnet.

Puppen der hügelbauenden Waldameisen
Dieses Puppenstadium dauert mit 14 bis 16 Tagen fast doppelt so lange wie das Larvenstadium.
Die Unterstützung durch die Arbeiterinnen endet auch in dieser Entwicklungsphase nicht. Der Wärmebedarf einer Puppe ist höher als der einer Larve. Deshalb werden die Puppen in wärmere und trockenere Bereiche des Nestes gebracht, wo die Temperatur etwa 30 Grad erreicht. Diese Temperatur wird normalerweise im oberen Teil des Nestes erreicht.
Lange Zeit glaubte man, dass Ameisen hauptsächlich durch Duftstoffe und Berührungen kommunizieren.
Bis Wissenschaftler mit empfindlichen Mikrophonen beobachteten, dass ältere Puppen Töne erzeugen und so mit ihren Arbeiterinnen kommunizieren können. Die Geräusche werden dabei durch das Aneinanderreiben von Körperteilen erzeugt.
Um Geräusche wahrzunehmen, sind Ameisen auf ihre Fühler angewiesen. An diesen befinden sich feine Härchen, mit denen sie Schallwellen wahrnehmen können.
Diese sind für den Menschen nicht hörbar und haben nur eine geringe Reichweite von etwa 10 cm.
Die Ameisen können nur die veränderliche Geschwindigkeit wahrnehmen, mit der sich der Schallimpuls von der Quelle wegbewegt und nicht wie wir Menschen mit unserem Gehör Luftdruckschwankungen als Töne interpretieren.
Puppen, von denen Geräusche nach außen dringen und von den Arbeiterinnen wahrgenommen werden, erhalten die volle Aufmerksamkeit der Arbeiterinnen. "Stille" Puppen werden dagegen vernachlässigt [1] [2] [3] [4].
Die Erzeugung und Wahrnehmung von Lauten spielt sicherlich auch in weiteren Bereichen der Kommunikation zwischen Ameisen eine wichtige Rolle, an der auch die Königin beteiligt ist.
Diese Art der Kommunikation haben sich übrigens auch einige ungebetene Gäste im Ameisennest zunutze gemacht. Aber dazu an anderer Stelle mehr.
Doch damit nicht genug: Ameisenpuppen sondern in den letzten Tagen ihrer Entwicklung eine seltsame Flüssigkeit ab, die so genannte Ameisenmilch. Auch diese Entdeckung hat viele Wissenschaftler überrascht. Diese Flüssigkeit sammelt sich in kleinen Tröpfchen auf der Puppenhülle. Ein Teil davon wird von den Arbeiterinnen selbst aufgenommen, den anderen Teil erhalten die Larven, die dazu extra zu den Puppen getragen werden.
Wird den Larven diese "Ameisenmilch" vorenthalten, können sie sich nicht richtig entwickeln oder sterben sogar ab.
Umgekehrt sind auch die Puppen darauf angewiesen, dass die von ihnen abgesonderte Flüssigkeit aufgenommen wird. Geschieht dies nicht, bilden die angesammelten Sekrete einen Nährboden für Pilze, was letztlich das Ende der Puppe bedeutet [5] [6].
Imago
Ist all dies überstanden, steht dem Schlüpfen einer neuen Arbeiterin nichts mehr im Wege. Auch für diesen letzten Schritt, das Öffnen und Verlassen des Kokons, stehen wieder hilfsbereite Arbeiterinnen bereit.

Nach dem Schlüpfen aus dem Ameisenkokon sind die "fertigen" Ameisen noch an ihrer hellen Färbung zu erkennen. Nach einigen Tagen hat sich ihr äußeres dunkel gefärbt und ihre Haut ist ausgehärtet. Ab diesen Zeitpunkt sind sie nicht mehr von den anderen Arbeiterinnen zu unterscheiden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung vom Ei bis zur fertigen Ameise ein spannender und sehr komplexer Prozess ist. Die einzelnen Stadien stehen in Wechselwirkung zueinander und die Entwicklung ist fein aufeinander abgestimmt.
Am Anfang dachte ich: Ei - Larve - Puppe - Ameise, das ist schnell erledigt. Aber wie immer, je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, desto spannender wird es!
 Seitenanfang
Seitenanfang
Links zum Thema:
- [1] Ameisenpuppen geben Laut 
- [2] Ameisen: Puppen zirpen um ihr Leben 
- [4] Ameisennachwuchs trommelt um sein Leben (Hörbeispiel) 
- [5] Ameisenkolonien produzieren eine Art Milch für ihre Larven 
- [6] Bahnbrechende Entdeckung: Ameisenpuppen versorgen Larven mit milchähnlicher Nährflüssigkeit 
Letzte Änderung am 12.10.2025